Ein altväterischer Weihnachtsabend ist ein norwegisches Märchen:
Das Märchen: Ein altväterischer Weihnachtsabend
Von Norden her pfiff der Wind durch die alten Ahorn- und Lindenbäume vor meinem Fenster. Der Schnee jagte die Straße hinab und der Himmel war so düster wie ein Dezemberhimmel in Christiania nur sein kann. Meine Stimmung war eben so düster. Es war der erste Weihnachtsabend, den ich nicht am heimischen Herde zubringen sollte.
Vor einiger Zeit war ich Offizier geworden und hatte gehofft, meine Eltern durch meine Anwesenheit zu erfreuen und mich zugleich den Damen meiner Heimat in Glanz und Herrlichkeit zu zeigen. Aber ein Nervenfieber hatte mich in das Lazarett gebraucht, aus dem ich erst seit einer Woche entlassen war. Ich befand mich augenblicklich in dem so hochgepriesenen Reconvalescentenzustande.
Ich hatte nach Hause geschrieben und um unsere Falbe und des Vaters Pelz gebeten. Aber vor dem zweiten Feiertage konnte der Brief kaum in unserem Tale ankommen. Erst zu Neujahr durfte ich das Eintreffen des Pferdes erwarten.
Meine Kameraden hatten die Garnison verlassen und kannte keine Familie, der ich mich hätte anschließen können. Die beiden alten Jungfern, bei denen ich wohnte, waren zwar freundlich und seelensgut und hatten sich meiner beim Beginn meiner Krankheit mit größter Sorgfalt angenommen. Aber ihre ganze Art und Weise war zu altväterisch, um der Jugend zu gefallen.
Ihre Gedanken weilten am liebsten bei der Vergangenheit. Wenn sie mir, wie es oft geschah, Geschichten über die Stadt und deren Verhältnisse erzählten, so mahnten diese sowohl durch ihren Inhalt als durch die naive Anschauungsweise an eine längst vergangene Zeit. Mit diesem altmodischen Wesen meiner Damen stand auch das Haus, welches sie bewohnten, In Übereinstimmung.
Es war eines jener alten Gebäude in der Zollhausstraße, mit tiefen Fenstern, langen finstern Gängen und Treppen, dunklen Zimmer und Böden, bei denen man unwillkürlich an Heinzelmännchen und Gespenster denken musste. Kurz, gerade so ein Gebäude, vielleicht war es sogar dasselbe, wie es Moritz Hansen in seiner Erzählung: „Der alte mit der Kapzue“ geschildert hat. Hinzu kam, dass ihr Umgangskreis sehr eingeschränkt war. Denn außer ein verheirateten Schwester verkehrten sie nur mit einigen langweiligen alten Damen. Leben verliehen diesem kleinen Kreise nur eine hübsche Schwestertochter und einige muntere, lebhafte Bruderskinder, welchen ich stets Märchen erzählen musste.
Ich suchte mich in meiner Einsamkeit und missmutigen Stimmung dadurch zu zerstreuen, dass ich die vielen Menschen betrachtete, die sich in Wind und Schneegestöber mit rotblauen Nasen und halb geschlossenen Augen die Straße auf und nieder bewegten.
Es belustigte mich, das Leben und Treiben zu beobachten, welches in der Apotheke gegenüber herrschte. Die Tür stand nicht einen Augenblick still. Dienstboten und Bauern strömten unablässig ein und aus und bemühten sich, sobald sie wieder auf die Straße kamen, die Etiketten zu studieren. Einigen schien die Entzifferung zu glücken. Aber mitunter gab ein langes Grübeln und ein bedenkliches Kopfschütteln zu erkennen, dass die Aufgabe zu schwer war.
Es dämmerte. Ich konnte die Gesichter nicht mehr unterscheiden, starrte jedoch noch immer nach dem alten Hause hinüber. Nach ihrem Äußern stand die Apotheke mit ihren dunklen rötlich braunen Mauern, ihren spitzen Giebeln und Türmen mit Wetterfahnen und in Blei eingefassten Fensterscheiben wie ein Denkmal der Baukunst aus den Zeiten Christian´s IV. da. Nur der Schwan nahm sich für die damalige wie jetzige Zeit mit einem goldenen Ringe um den Hals, Reitstiefeln an den Füßen und zum Fluge ausgespannten Schwingen sehr würdig und ehrbar aus.
Ich war gerade im Begriff, mich in Betrachtungen über gefangene Vögel zu vertiefen, als ich durch Lärm und Kindergelächter im Nebenzimmer und ein leises jungfräuliches Klopfen an der Tür unterbrochen wurde.
Auf mein „Herein“ trat die älteste meiner Wirtinnen, Jungfer Mette, mit einem altmodischen Knicks herein, erkundigte sich nach meinem Befinden und bat mich unter vielen Umschweifen heute Abend bei ihnen fürlieb nehmen zu wollen.
„Es ist Ihnen nicht gut, lieber Herr Leutnant, hier im Finstern allein zu sitzen,“ fügte sie hinzu. „Wollen Sie nicht sogleich mit hinüber kommen? Die alte Mutter Skau und die kleinen Mädchen meines Bruders sind auch da. Das wird sie vielleicht etwas zerstreuen. Sie haben ja die fröhlichen Kinder so lieb.“
Ich folgte der freundlichen Einladung. Als ich eintrat, verbreitete ein Feuer, welches in einem großen viereckigen Kasten von Kachelofen loderte, durch die weit geöffnete Tür einen roten flackernden Lichtschein über das Gemach. Dasselbe war sehr tief und nach alter Mode mit hochlehnigen Polsterstühlen, so wie mit einem jener Kanapees möbliert, die nur auf Reifröcke und stocksteife Haltung berechnet schienen. Die Wände waren mit Ölgemälden geschmückt, Brustbildern steifer gepuderter Damen, hohe Ratsherren und anderer berühmter Personen in Panzer und Harnisch oder roten Röcken.
„Sie müssen entschuldigen, Herr Leutnant, dass wir noch nicht Licht angezündet haben,“ sagte Jungfer Cäcilie, die jünger Schwester, welche für gewöhnlich Sillemutter genannt wurde. Sie kam mit mit einem Knickse entgegen, der dem ihrer Schwester nichts nachgab, „aber die Kinder tummeln sich in der Dämmerung gern um das lodernde Ofenfeuer und Mutter Skau hat ebenfalls ihr größtes Behagen an einem muntern Geplauder in der Ofenecke.
„Geplauder hin, Geplauder her, du schwatzest selbst gern in der Dämmerstunde, Sillemutter, und dann sollen wir daran schuld sein,“ erwiderte die alte engbrüstige Dame, die Mutter Skau tituliert wurde.
„Ei, sie da, guten Abend mein Bester. Kommen Sie und setzen Sie sich zu mir und erzählen Sie mir, wie es Ihnen geht. Es hat Sie meiner Treu tüchtig mitgenommen,“ sagte sie zu mir und sich sich auf ihr eigenes aufgedunsenes Aussehen etwas Gutes zu tun.
Ich musste ihr nun meine Erlebnisse erzählen und zum Lohn einen langen und umständlichen Bericht über ihre Gicht und ihre asthmatischen Leiden anhören. Der wurde aber zum Glück durch die lärmende Rückkehr der Kinder aus der Küche, wo selbst sie dem alten Hausinventarium Stine einen Besuch abgestattet hatten, unterbrochen.
„Tante, weiß du, was Stine sagt?“ rief ein kleines lebhaftes braunäugiges Bürschchen. „Sie sagt, ich soll heute Abend mit auf den Heuboden gehen und unserm Heinzelmännchen die Weihnachtsgrütze bringen. Aber ich will nicht, ich fürchte mich vor dem Heinzelmännchen.“
„Ach, das sagt Stine nur, um euch los zu werden. Sie wagt sich im Finstern selbst nicht auf den Heuboden hinauf, die Närrin, denn sie hat es noch nicht vergessen, wie Heinzelmännchen sie einmal in Schrecken versetzt hat,“ entgegnete Jungfer Mette. „Aber wollt ihr denn den Herrn Leutnant nicht begrüßen, Kinder?“
„Wie, bist Du es wirklich, Leutnant? Ich hätte Dich nicht wieder erkannt! Wie blass Du bist? Ich habe Dich so lange nicht gesehen,“ riefen die Kinder durcheinander und scharten sich um mich.
„Nun musst Du uns etwas Lustiges erzählen, denn Du hast uns so lange nichts erzählt, lieber guter Leutnant. „Erzähle uns vom Butterbock und Goldzahn!“
Ich musste ihnen vom Butterbock und dem Hunde Goldzahn erzählen und noch eine Geschichten zum Besten geben. Wie auf den Gehöften zu Vager und Bure sich einst die Heinzelmännchen gegenseitig Heu stahlen, einander, jedes mit einer Last Heu auf dem Rücken, trafen und sich balgten, bis sie unter einer Heuwolke verschwanden. Ich musste von dem Heinzelmännchen auf dem Gute Hesselberg erzählen, der den Hofhund neckte, bis ihn der Besitzer zur Scheunentenne hinauswarf. Die Kinder klatschten in die Hände und lachten. „Das war dem garstigen Heinzelmännchen ganz recht,“ sagte sie und verlangten eine neue Geschichte.
„Nein, ihr plagt den Herr Leutnant zu viel, Kinder, „sagte Jungfer Cäcilie, „nun erzählt Tante Mette wohl eine Geschichte.“
„Ja, erzähle, Tante Mette!“ war der allgemeine Ruf.
„Ich weiß nicht recht, was ich erzählen soll,“ erwiderte Tante Mette. „Aber da gerade vom Heinzelmännchen die Rede ist, so will ich euch auch etwas von ihm erzählen. Ihr erinnert euch wohl noch der alten Kari Gusdal, Kinder, die hier war und so gut Fladenbrot und Kuchen buk und die immer so viele Märchen und Geschichten zu erzählen wusste.“
„Ach ja,“ riefen die Kinder.
„Nun, die alte Kari erzählte, dass sie vor vielen Jahren hier im Waisenhause gedient hätte. Damals war es noch einsamer und unfreundlicher als jetzt in jener Gegend der Stadt und überdies ist das Waisenhaus ein düsteres und unheimliches Gebäude. Kari diente dort als Köchin und sie war ein sehr flinkes und gewandtes Mädchen. Als sie in einer Nacht aufstehen und brauen sollte, sagten die anderen Dienstboten zu ihr:
„Hüte dich ja, zu früh aufzustehen. Vor zwei Uhr darfst du nicht einmaischen!“
„Warum denn nicht?“ fragte sie.
„Du wirst doch wissen, dass wir hier ein Heinzelmännchen haben und du kannst dir denken, dass es nicht so früh gestört sein will und vor zwei Uhr darfst du auf keinen Fall brauen,“ erwiderten sie.
„Pah, wenn´s weiter nichts ist,“ entgegnete Kari, die immer sehr kurz angebunden war, „ich habe mit dem Heinzelmännchen nichts zu schaffen. Kommt er mir zu nahe, so will ich ihn, hole mich dieser oder jener , schnell genug zur Türe hinaus jagen!“
Die Anderen redeten ihr zu, aber sie bestand auf ihrem Kopfe und kurz nachdem es ein Uhr geschlagen hatte, stand sie auf, machte Feuer unter dem Braukessel und goss die Maischmasse hinein. Aber unaufhörlich erlosch das Feuer und es war, als ob Jemand die brennenden Holzstücke zum Schornstein hinauswürfe. Aber wer es war, konnte sie nicht sehen. Sie sammelte das brennende Holz ein Mal nach dem andern, aber es half nichts und aus dem Gebräu wurde auch nichts. Zuletzt hatte sie es satt, ergriff ein brennendes Holzstück, lief damit umher, schwang es bald nach oben, bald nach unten und rief:
„Pack dich dahin, woher du gekommen bist. Bildest du dir ein, mich in Angst setzen zu können, so irrst du dich!“
„Hüte dich!“ antwortete es aus einem der finstersten Winkel, „hier im Hause sind schon sieben Seelen mein geworden. Ich dachte, ich sollte auch noch die achte bekommen.“
„Seit der Zeit, „sagte Kari Gusdal, „hat man im Waisenhause nichts wieder vom Heinzelmännchen gesehen oder gehört.“
„Mir wird ganz bange,“ sagte eines der kleinen Mädchen, „nein, du musst erzählen, Leutnant. Wenn du erzählst, fürchte ich mich nie, denn du erzählst immer was Lustiges.“
Ein anderes schlug vor, ich solle von dem Heinzelmännchen erzählen, welches mit dem Mädchen den Hallingtanz tanzte. Darauf ließ ich mich sehr ungern ein, weil Gesang dazu gehörte, allen sie ließen mich durchaus nicht los. Schon begann ich mich zu räuspern, um meiner höchst unharmonischen Stimme zu der Melodie des Hallingtanzes, die dazu gehörte, etwas Klang zu verleihen, als zur Freude der Kinder und zu meiner Erlösung die erwähnte hübsche Nichte hereintrat.
„Jetzt will ich erzählen, Kinder, wenn ihr Cousine Lieschen bewegen könnt, den Gesang zu übernehmen,“ sagte ich, „und ihr tanzt dann selber, nicht wahr?“
Cousinchen wurde von den Kleinen bestürmt, versprach die Tanzmusik auszuführen und ich begann meine Erzählung:
„Es war einmal irgendwo, ich glaube fast, es wir im Hallingtale, ein Mädchen, welches dem Heinzelmännchen den Milchbrei bringen sollte, ob es an einem Donnerstagabend oder an einem Weihnachtsabend war, entsinne ich mich nicht mehr, ich glaube aber fast, es war an einem Weihnachtsabend. Nun hielt die Magd es für eine wahre Sünde, dem Heinzelmännchen die gute Speise zu geben. Sie aß deshalb selbst den Milchbrei mit samt dem Schmal darauf und brachte Hafergrütze und sauer Milch in einem Schweinetroge nach der Scheune.
„Da hast du deinen Trog, du garstiges Geschöpf!“ sagte sie.
Aber kaum hatte sie dies gesagt, als schon Heinzelmännchen auf sie losfuhr, sie ergriff und einen Tanz mit ihr begann. Er tanzte und tanzte, bis sie dalag und nach Luft schnappte. Als am folgenden Morgen Leute in die Scheune kamen, war sie mehr tot als lebendig. Aber so lange er tanzte, sang er – und hier übernahm Jungfer Lieschen Heinzelmännchens Rolle und sang im Hallinger Takte:
Den Brei aßest auf ganz dem Heinzelmann du,
Ei so tanz´ auch, so tanz´ mit dem Heinzelmann du!
So ging es eine Weile fort und dabei halb ich mit beiden Füßen den Takt zu treten, während sich die Kinder lärmend und jubelnd untereinander im Zimmer umher tummelten.
„Ich glaube, ihr kehrt das Unterste zu oberst, Kinder, ihr lärmt, dass mir der Kopf weh tut,“ sagte Mutter Skau. „Wenn ihr jetzt still ein wollt, werde ich euch einige Geschichten erzählen.“ Es wurde im Zimmer mäuschenstill und Frau Skau begann:
„Die Leute erzählen sich jetzt so viel von Heinzelmännchen und Berggeistern und dergleichen, aber ich glaube nicht recht daran. Ich habe weder diese noch jene gesehen. Freilich bin ich in meinem Leben auch noch nicht weit umher gekommen. Ich halte es für bloßes Geschwätz. Die alte Stine da draußen in der Küche behauptet, das Heinzelmännchen gesehen zu haben. Als ich den Konfirmandenunterricht besuchte, diente sie bei meinen Eltern. Zu ihnen war sie von einem Schiffer gekommen, der sich zur Ruhe gesetzt hatte. Bei diesem war es sehr still und ruhig. Ihre Herrschaft ging nie auf Besuch und empfing nie Besuch. Der Herr ging nie weiter als bis zur Landungsbrücke hinab. Stets wurde früh zu Bett gegangen. Dort im Hause war, wie es hieß, ein Heinzelmann.
Eines Abends, erzählte Stine, saßen wir, ich und die Köchin, oben in der Mägdekammer und wollten für uns selbst nähen und ausbessern. Es war um die Schlafenszeit, denn der Wächter hatte schon zehn gerufen. Es wollte uns aber gar nicht von der Hand gehen. Aller Augenblicke fielen uns die Augen zu und bald nickte ich bald wieder sie, denn wir waren früh aufgestanden und hatten am Morgen gewaschen.
Als wir so dasaßen, hörten wir plötzlich ein fürchterliches Gepolter draußen in der Küche. Ich schrie: Gott tröste uns und steh uns bei. Das ist das Heinzelmännchen. Mir wurde so bange, dass ich den Fuß nicht in die Küche zu setzen wagte. Die Köchin fürchtete sich zwar ebenfalls. Sie faste sich ein Herz und als sie hinaus in die Küche kam, lagen sämtliche Teller auf dem Fußboden. Kein einziger war zerbrochen. In der Tür stand das Heinzelmännchen mit einer roten Mütze auf dem Kopfe und lachte so recht herzlich gutmütig.
Nun hatte sie aber gehört, dass sich das Heinzelmännchen bisweilen anführen und zum Umzuge bewegen ließe, wenn Jemand es darum bäte und ihm vorstellte, dass es an einem andern Orte ungestörter wäre. Deshalb sagte sie zu ihm, die Stimme bebte ihr doch ein wenig dabei, es möchte doch zu dem Kuperschmiede gerade gegenüber ziehen, dort wäre es viel stiller und ruhiger, denn da gingen sie jeden Abend Schlag neun Uhr zu Bette.
Das ist auch wahr, sagte sie zu mir, aber du weißt ja doch auch, dass der Meister mit allen Gesellen und Burschen vor drei Uhr morgens auf ist und den ganzen Tag arbeitet und lärmt. Seit diesem Tage, sagte sie, sahen wir das Heinzelmännchen nicht mehr bei dem Schiffer.
Aber bei dem Kupferschiede gefiel es ihm recht gut, obgleich sie den ganzen Tag hämmerten und klopften. Die Leute erzählten sich, dass ihm die Frau jeden Donnerstagabend Grütze auf den Boden hinstellte. So kann man sich denn auch nicht wundern, dass sie reich wurden, denn das Heinzelmännchen trug ihnen wohl vieles zu, sagte Stine. Es ist wahr, sie brachten es zu etwas und wurden reiche Leute. Ob es das Heinzelmännchen war, das ihnen dazu verhalf, kann ich nicht sagen,“ fügte Mutter Skau hinzu und hustete und räusperte sich nach der Anstrengung, welche ihr die ungewöhnlich lange Erzählung bereitet hatte.
Nachdem sie eine Prise Tabak genommen hatte, fühlte sie sich wieder gekräftigt und begann aufs Neue.
„Meine Mutter war eine wahrheitsliebende Frau. Sie erzählte eine Geschichte, die sich hier in der Stadt zugetragen hat und zwar in einer Weihnachtsnacht. Dass die Geschichte wahr ist, weiss ich, denn aus ihrem Munde kam nie ein unwahres Wort.“
„Lassen Sie sie uns doch hören, Frau Skau,“ sagte ich. „Erzähle, erzähle, Mutter Skau,“ riefen die Kinder.
Sie hustete ein wenig, nahm abermals eine Prise und begann:
„Als meine Mutter noch ein Mädchen war, kam sie mitunter zu einer Witwe, welche sie kannte. Sie hieß, ja wie hieß sich doch nur gleich? Frau – richtig, Frau Evensen hieß sie. Sie war eine Frau, die nur wenig über ihr bestes Alter hinaus war, aber ob sie sie oben in der Müllerstrasse oder im Winkel auf dem kleinen Kirchhügel wohnte, das kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen.
Nun war es gerade ein Weihnachtsabend wie heute. Da dachte sie bei sich selbst, so wollte am Weihnachtsmorgen in die Frühpredigt gehen. Sie war eine fleißige Kirchgängerin und deshalb stellte sie Wasser zum Kaffee auf, damit sie etwas Warmes zu sich nehmen könne und nicht nüchtern auszugehen brauchte.
Als sie erwachte fielen die Mondstrahlen auf den Fußboden. Als sie nun aufstand und nach der Uhr sehen wollte, war diese stehen geblieben und der Zeiger wies auf halb Zwölf. Da sie nicht wusste, wie spät in der Nacht es war, so ging sie an das Fenster und sah nach der Kirche hinüber. Alle Kirchenfenster waren hell erleuchtet. Sie weckte die Magd und lies dieselbe, während sie ankleidete, Kaffee kochen und darauf nahm sie das Gesangbuch und ging in die Kirche. Es war auf der Straße vollkommen still und sie sah nicht einen Menschen auf dem Wege.
Als sie in die Kirche kam, setzte sie sich in den Stuhl, in welchem sie gewöhnlich zu sitzen pflegte. Als sie sich umschaute, kam es ihr vor, als sähen die Leute alle so blass und seltsam aus, als ob sie alle tot wären. Sie erkannte niemand, dagegen glaubte sie viele schon früher gesehen zu haben, wenn sie sich auch nicht erinnern konnte, wo dies geschehen war. Der Prediger, welcher auf der Kanzel erschien, gehörte nicht zu der Geistlichkeit der Stadt. Es war ein großer bleicher Mann, von dem sie ebenfalls meinte, dass sie ihn kennen müsste.
Er predigte gar schön und man vernahm nichts von dem Geräusch und Husten und Räuspern, welches sonst während der Frühpredigt am Weihnachtsmorgen stattzufinden pflegt, sondern es war so still, dass sie hätte können eine Nadel zur Erde fallen hören. Ja, so still, dass ihr ganz angst und bange wurde.
Als der Gesang wieder begann, beugte sich eine Frau, die neben ihr saß zu ihr hin und flüsterte ihr zu:
„Wirf den Mantel lose um Dich und geh. Denn wartest Du, bis der Gesang zu ende ist, so ist es um Dich geschehen. Es sind die Toten, die ihren Gottesdienst halten.“
„Ach, mir wird Angst, mir wird Angst, Mutter Skau,“ jammerte eines der Kleinen und kletterte auf einen Stuhl.
„Still, still, Kind, sie kommt noch ganz gut davon. Jetzt sollst du es hören,“ versetzte Mutter Skau. „Aber der Witwe ward ebenfalls angst. Denn als sie die Stimme hörte und die Frau ansah, erkannte sie dieselbe. Es war ihre Nachbarin, welche vor vielen Jahren gestorben war. Als sie sich jetzt in der Kirche umblickte, erinnerte sich deutlich, dass sie sowohl den Prediger als auch viele Gemeindemitglieder früher gesehen hatte und dass diese vor vielen Jahren gestoben waren.
Das Blut erstarrte in ihr, so angst wurde ihr. Sie warf den Mantel lose um sich und ging ihrer Wege. Da war es ihr, als ob sich Alle umwendeten und nach ihr griffen. Die Beine wankten unter ihr, dass sie fast zu Boden gesunken wäre. Als sie auf die Kirchentreppe hinaus kam, fühlte sie, wie sie am Mantel ergriffen wurde. Sie ließ ihn los und eile, so schnell sie konnte, nach Hause. Kaum war sie an ihrer Haustüre, da schlug es ein Uhr. Als sie hineinkam, war sie fast halb tot. So ängstigte sie sich.
Am Morgen, als die Leute nach der Kirche kamen, lag der Mantel auf der Treppe, aber er war in tausend Stücke zerrissen. Meine Mutter hatte ihn früher oftmals gesehen und ich glaube, sie hat auf eines der Stücke gesehen. Aber das ist nun einerlei, es war ein kurzer Mantel von hellrotem Stoff mit Futter und Besatz von Hasenfell, wie sie in meiner Kindheit noch Mode waren. Jetzt sieht man selten einen solchen. Aber es gibt hier in der Stadt und in dem Stifte in der Altstadt noch einige alte Frauen, die ich am Weihnachtsfeste in der Kirche mit solchen Mängeln sehe.“
Die Kinder, welche während des letzten Teiles der Erzählung viel Furcht und Angst zu erkennen gegeben hätte, erklärten, dass sie solche hässliche Geschichten nicht mehr hören wollten. Sie waren auf das Kanapee und die Stühle geklettert und sagten, es scheine Jemand unter dem Tische zu sitzen und ihnen zu greifen. In diesem Augenblicke wurden Lichter auf altmodischen Armleuchtern hereingebracht und man entdeckte unter vielem Lachen, dass sie mit den Beinen auf dem Tische dasaßen.
Die Lichter und der Weihnachtskuchen, Eingemachtes, Backwerk und Wein verjagten bald Spukgeschichten und Furcht, belebten die Gemüter und lenkten das Gespräch auf den lieben Nächsten und die Tagesneuigkeiten. Endlich gab der Reisbrei und der Rippenbraten den Gedanken eine Richtung auf das Solide. Man schied zeitig voneinander, indem man sich ein fröhliches Weihnachtsfest wünschte.
Aber ich hatte ein sehr unruhige Nacht. Ich weiß nicht, ob die Erzählungen, die genossenen Speisen, meine Schwäche oder alles dies zusammen die Schuld trugen. Ich lag da und warf mich hin und her und qälte mich die ganz Nacht mit Heinzelmännchen-, Geister- und Spukgeschichten. Zuletzt fuhr ich Schellengeläute durch die Luft nach der Kirche. Diese war erleuchtet und als ich hineinkam, war es die Kirche in meinem heimatlichen Tale.
Nur Talbewohner mit roten Mützen, Soldaten in vollem Staat und Bauernmädchen mit Kopftüchern und roten Wanen waren darin zu sehen. Der Pfarrer stand auf der Kanzel. Es war mein Großvater, der schon gestorben, als ich noch ein kleiner Junge war. Aber als er sich im besten Predigen befand, schlug er plötzlich – er war als ein flinker Mann bekannt – einen Purzelbaum mitten in die Kirche hinab, dass der Priesterrock auf die eine und der Kragen auf die andere Seite fiel. „Da liegt der Priester und hier bin ich,“ sage er mit einem seiner bekannten Ausdrücke, „und nun lasset uns einen Springtanz aufführen!“
Augenblicklich tummelte sich die ganze Gemeinde im wildesten Tanze umher und ein großer langer Talbauer kam auf mich zu. Er ergriff mich bei der Schulter und sagte: „Du musst auch mit, Karl!“
Ich wusste nicht, was ich denken sollte, als ich in diesem Augenblick erwachte, einen Griff an meiner Schulter fühlte und sich derselbe Mann, den ich im Traume gesehen hatte, über mein Bett beugte, die Mütze tief über die Ohren hinabgezogen, einen Pelz auf dem Arme und ein paar große Augen starr auf mich gerichtet.
„Du träumst gewiss, Karl,“ sagte er, „der Schweiß steht Dir auf der Stirn und Dein Schlaf ist tiefer als der Winterschlaf eines Bären. Ich soll Dir Gottes Frieden und ein fröhliches Weihnachtsfest von Deinem Vater und den Leuten im Tale wünschen. Hier ist ein Brief vom Herrn Amtsrichter und der Pelz für Dich, die Falbe aber steht im Hofe.“
„Aber um Gotteswillen, bist Du es, Thor?“ Es war meines Vaters Knecht, das echte Urbild eines Talbauers.
„Wie in aller Welt bist Du hierher gekommen?“ rief ich freudig.
„Nun, das will ich Dir sagen,“ erwiderte Thor, „ich komme mit der Falbe. Ich war gerade mit dem Herrn Amtsrichter draußen am Strande und da sagte er zu mir: Thor, von hier ist es nicht weit in die Stadt. Nimm doch die Falbe und fahre hinein und sieh nach dem Leutnant. Wenn er gesund ist und mitfahren kann, so nimm ihn mit, sagte er.“
Als wir aus der Stadt fuhren, war es wieder gutes Wetter und wir hatten die prächtige Fahrt. Die Falbe legte aus mit ihren alten flinken Beinen und so ein Weihnachten, wie ich damals erlebte, habe ich niemals erlebt, weder vorher noch nachher.
—————
Quelle:
Auswahl norwegischer Volksmärchen und Waldgeister-Sagen
P. Chr. Asbjörnsen, Verlag Adolph Neselshöfer, Leipzig, 1881


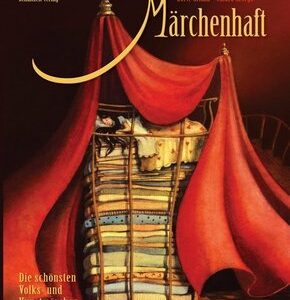
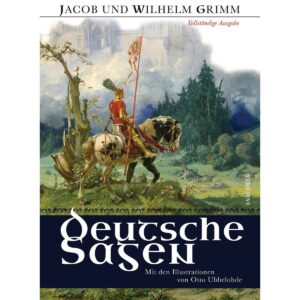

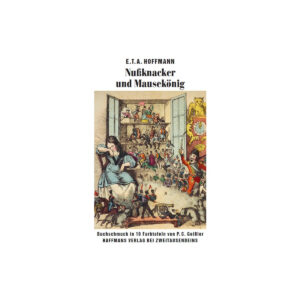








 Users Today : 2
Users Today : 2 Users Yesterday : 2
Users Yesterday : 2 Users This Month : 109
Users This Month : 109 Total Users : 1195
Total Users : 1195 Views Today : 3
Views Today : 3 Views Yesterday : 5
Views Yesterday : 5 Views This Month : 157
Views This Month : 157 Views This Year : 1518
Views This Year : 1518 Total views : 2090
Total views : 2090 Who's Online : 0
Who's Online : 0