Von den achtzehn Soldaten ist ein Märchen aus der Sammlung von J. W. Wolf.
Das Märchen: von den achtzehn Soldaten
Achtzehn Soldaten, nämlich ein Feldwebel, ein Sergeant, ein Korporal, ein Tambour und vierzehn Gemeine waren zusammen auf einer einsamen Wacht.
Weil nun der Dienst sehr hart und das Traktement (Anm. Red.: Gehalt, Lohn) schlecht war, so tat sich die ganze Wachmannschaft zusammen und beschloss, zu desertieren. Nur der Feldwebel, der ein alter Soldat war und zwei Feldzüge mitgemacht hatte, wollte Nichts von der Sache wissen.
Da er´s nicht anders wollte, so banden sie ihm Hände und Füße zusammen, auf dass er nicht in Verantwortung und Strafe käme. Sie legten ihn unter die Pritsche und gingen alle Siebenzehn mit Sack und Pack davon.
Sie waren aber kaum ein paar hundert Schritt weit gegangen, so fiel dem Korporal ein, dass er seine Pfeife auf dem Tisch hatte liegen lassen. Er ging zurück, um sie zu holen.
Unter dessen hatte sich der Feldwebel unter die Pritsche die Sache noch ein Mal überlegt. Weil er dachte, er könnte doch vielleicht in harte Strafe kommen, so ward er anderen Sinnes. Es reute ihn, dass er nicht mitgegangen war.
Als nun der Korporal wieder hereintrat sprach er: „Bind mich los, Kamerad, es liegt sich unter der Pritsche noch schlechter, als oben darauf.“ Als er los war, schloss er die Wachstube zu, steckte den Schlüssel ein und desertierte mit.
Eine schöne Zeit waren sie zusammen umhergezogen. – Das Geld war alle, aber der Hunger und der Durst noch nicht. Sie dachten Mittags zuweilen an den großen Fleischkessel in der Kaserne. – Da kamen sie einmal an ein einsames Waldwirtshaus. Sie gingen hinein, der Feldwebel klapperte mit dem Schlüssel und ein paar Gamaschen Knöpfen im Sack. Sie ließen sich einschenken und auftragen was in der Küche und im Keller war.
Als es darnach ans Bezahlen ging, griff der Feldwebel in den Sack, als wenn er ein Paar von seinen Kronentalern wollte springen lassen. Aber „das kann nicht sein, Herr Feldwebel“, rief der Sergeant, „an mir ist das Bezahlen!“. Er griff dabei in seinen Hosensack, der Feldwebel aber ging einstweilen hinaus. „Haltet ein, Herr Sergeant!“ rief jetzt der Korporal, „wollt Ihr immer noch die Zache bezahlen?“. Dabei fuhr er eilig in die Tasche, der Sergeant aber ging einstweilen hinaus.
Da sprach der Tambour: „an mir ist heute die Reihe, soll ich mich immer von euch füttern lassen?“ und der Korporal folgte den Andern. Von dem Tambour wollte sich aber der älteste Gemeine nicht lumpen lassen. Und so immer fort. Keiner von dem Andern, bis herunter zu dem jüngsten Soldaten, der noch ein Rekrut war. Der aber sprach, er wolle die Anderen noch einmal alle hereinrufen, damit man genau nachrechnen könnte, was jeder gegessen und getrunken. – Fort war er und lief den anderen Siebenzehn nach.
Der Wirt hätte schwarz und blau vor Ärger werden mögen, als er sich so geprellt sah. Doch weil er ein böser heimtückischer Mann war, machte er das Fenster auf und rief seinen Gästen mit freundlicher Stimme nach: „Was lauft ihr also, ihr braven Burschen. Kommt zurück, euer Spaß gefällt mir also wohl, dass ich euch noch eine Zehrung mit auf den Wegen geben will!“
Als sie nun wiederkamen, gab er noch einem Jeden einen halben Gulden. Sie sollten doch den Weg rechter Han einschlagen und dann das zweite Pfädchen links gehen. Sie würden an einen Berg mit einer offenen Tür kommen, wenn sie da hineingingen, so möchten sie glücklich werden für all ihr Lebtag!
Das leuchtete den Soldaten ein. Sie dankten für die Zehrung und den guten Rat. Sie versprachen auch, nicht wiederzukommen und machten sich spornstreichs auf den Weg nach dem Berge. Der Wirt aber freute sich, dass ihm sein schlimmer Anschlag so wohl gelungen war. Denn in den Berg hinein war schon gar Mancher gegangen, aber Keiner wieder heraus.
Die Achtzehn gingen den Weg rechter Hand und an dem großen Baum das zweite Pfädchen links und dann durch die offene Tür in den Berg hinein. Da drinnen war es ganz hell, wie draußen auch. Eine schöne breite Straße führte immer weiter hinein.
Da sie ein gutes Stück darauf fort marschiert waren, kamen sie vor eine aufgezogene Zugbrücke. Die ließ sich aber von selber vor ihnen herab, dass sie darüber gehen konnten. Nun waren sie in einem großen Hof. Sie wanderten wieder eine Zeitlang weiter. Dann kamen sie an eine zweite Zugbrücke, die sich niederließ wie die erste und über welche sie in einen andern Hof gelangten. Ebenso ging es noch einmal über eine dritte Brücke und in einen dritten Hof. Da stand aber mitten darin ein wunderschönes Schloss.
„Rangiert euch!“ kommandierte der Feldwebel. Er ließ die Mannschaft in Reihe und Glied herantreten und die Unteroffiziere auf die Flügel. „Geschwindschritt Marsch!“ hieß es dann, der Tambour schlug ein und die Achtzehn marschieren zum Schlosstor hinein. Als sie darinnen waren erklärten sie das Schloss für erobert.
Sie hatten freilich gut erobern. Es war ringsum nichts Lebendiges zu sehen und zu hören. Wohl aber fanden sie einen großen Saal, wo für achtzehn Mann gedeckt und aufgetragen war, was ihnen gar wohl gefiel. Neben dem Saale waren achtzehn schöne Schlafkämmerchen. Eines wie das andere, ein jedes mit einem prächtigen seidenen Bett. Das gefiel ihnen auch.
Nun setzten sie sich ohne weiteres zu Tisch, damit es nicht kalt werden sollte und lebten hoch in Freuden bis in die Nacht hinein. Dann krochen sie in die weichen seidenen Betten und schliefen wie die Grafen.
Der Feldwebel war der erste, der des anderen Morgens wieder aufwachte. Er wollte sich anziehen und den Tambour wecken, dass er Reveille (Anm. Red.: Weckruf) schlüge, doch seine Montur war fort und nirgends mehr zu sehen. Er hing sich das Betttuch um und rief seinen Kameraden. Da kamen sie auch heraus, Einer nach dem Andern. Aber Einer wie der Andere im Betttuch, gleich dem Feldwebel, denn ihre Kleider waren auch verschwunden, als wären sie niemals dagewesen.
Als sie sich im Saale umschauten, sahen sie mitten auf dem Tisch zwei große Kisten stehen. Sie machten den Deckel auf, da fanden sie in dem einen Kasten eine Feldwebelsmontur, eine Sergeanten-, eine Korporals- und eine Tambours-Montur und vierzehn Stück gemeine Soldatenmonturen. Alles war funkelnagelneu, als wenn es eben vom Schneider käme und passte wie angegossen.
In den anderen Kisten waren siebenzehn prächtige neue Gewehre, Säbel und Patronentaschen und eine nagelneue Trommel für den Tambour! Das war eine Herrlichkeit!
Als die erste Freude vorüber war, sagte der Feldwebel, weil sie jetzt wieder das Ansehen von ordentlichen Soldaten hätten, so wollten sie auch ihren Dienst tun wie es sich gehöre.
Darauf führte er einen Teil der Mannschaft in die Wachtstube am Schlosstor. Er teilte sie zum Schildwachtstehen in drei Nummern ab und von nun an mussten sie ordentlich auf Posten ziehen und alle zwei Stunden ablösen wie es sich gehörte.
Als sie es schon eine Zeit lang so getrieben hatten, da kam eines Tages eine prächtige sechsspännige Kutsche angefahren und hielt vor dem Schlosstor. Ein Bedienter in einem goldenen Rock machte den Schlag auf und eine wunderschöne Dame steig heraus. Sie ließ sich von der Schildwache den Feldwebel herausrufen, ging mit ihm hinauf in seine Schlafkammer und sprach zu ihm: „Ich bin eine verwünschte Prinzessin. Du aber sollst mich erlösen und mein Bräutigam sein. Von Morgen an wird jeden Tag eine andere Prinzessin kommen. Die erste zum Sergeanten, die zweite zum Korporal und so immer fort, bis ein Jeder von euch die Seinige gesehen und mit ihr gesprochen hat. Also muss es geschehen, damit ihr uns erlösen könnt.“
Das und noch Anderes redete sie mit dem Feldwebel, ehe sie von dannen fuhr und wie sie gesagt, so kam es.
Die zweite Prinzess kam des anderen Tages, ging mit dem Sergeanten hinauf in die Kammer und beredete sich allda mit ihm. So ging es immer weiter, jeden Tag kam eine andere und Eine immer noch schöner als die Andere. Dem jüngsten Soldaten blieb aber die Seinige gar zu lange. Weil er dachte, wer weiß wann die Reihe an mich kommt, so entschloss er sich kurz und desertierte.
Als er wieder an die erste Brücke kam, so stund da der Teufel und frug ihn: „Wohinaus?“ „Aus dem Berg heraus!“ sprach der Soldat. Da fasste ihn der Teufel und drehte ihm das Genick ab.
Als die anderen Soldaten ihren Kameraden vermissten, schickte der Feldwebel eine Patrouille aus, um ihn zu suchen. Bald fanden sie ihn denn auch tot am Boden liegen. Er hatte seine alten zerrissenen Kleider wieder an, die er mitgebracht und regte kein Glied mehr.
Aber noch an demselbigen Tages kam die älteste Prinzessin wieder angefahren, ging mit ihrem Feldwebel hinauf und sprach zu ihm: „Dass euer Kamerad desertiert ist, das hat die ganze Erlösung verdorben. Entweder müsst ihr jetzt wieder einen achtzehnten Mann herbeischaffen, dass Alles von Neuem beginnen kann oder ihr seid des Todes alle Siebenzehn.“ So sprach sie und fuhr wieder weg.
Nun berief der Feldwebel die ganze Mannschaft zu sich. Er hielt einen Rat mit ihnen, was sie tun sollten. Sie wurden sich einig, dass der Korporal mit zwei Gemeinen auf Werbung ausziehen müsse nach dem achtzehnten Mann.
Als nun die Drei an die erste Brücke kamen, stand der Teufel davor und frug: „Wohinaus?“ „Auf Werbung“, sprach der Korporal. „Passiert!“ rief der Teufel und ließ sie hinaus. So gelangten sie ungehindert über die drei Brücken bis vor den Berg. Sie gingen dieselben Wege, die sie früher hergekommen waren zurück, fanden bald auch das Waldwirtshäuslein von damals wieder.
Sie setzten sich an den Tisch zu dem Wirt, der sie in den Berg hineingeschickt hatte. Weil sie aber so sauber und ordentlich aussahen, erkannte er sie nicht mehr und sie taten, als ob sie ihn auch nicht kennten.
Es dauerte nicht lange, so kam ein armer Handwerksbursch herein. Er setzte sich ganz traurig an einen anderen Tisch und ließ sich ein Stück trocken Brot geben und ein Glas Wasser dazu. Da riefen ihn die drei Soldaten zu sich, gaben ihm Wein zu trinken und Braten zu essen. Da er nun satt war und guter Dinge wurde, fragten sie ihn, ob er nicht für ein gutes Handgeld sich wolle anwerben lassen? Das gefiel dem Handwerksburschen schlecht, deshalb antwortete er im Spott, wenn sie ihm hundert Gulden Handgeld geben wollten, so wär er´s zufrieden.
Der Korporal aber, der sich aus der Schatzkammer des verwünschten Schlosses einen ganzen Tornister voll Geld mitgebracht hatte, zählte ihm auf der Stelle zweihundert Dukaten auf den Tisch und Sache war abgemacht. Sie machten sich nun auf den Heimweg. Der Teufel ließ sie ungehindert einpassieren und im Schloss gab es eine große Freude, als sie mit dem Rekruten ankamen.
Als sie aber aus dem Wirtshaus weg waren, sprach zum Wirt die Wirtin: „Du bleibst doch ein Esel all dein Lebtag, sonst hättest du gemerkt, dass der Korporal und die zwei Soldaten schon ein Mal bei uns waren, unter den achtzehn lumpigen Kerlen, die dich so schmählich angeführt haben. Und zum Lohn dafür hast du sie glücklich gemacht für all dein Lebtag!“
„Wie sie das meine?“ frug der Wirt.
„Ei du Narr“, sprach sie. „Hast du denn das viele Gold nicht gesehen? Das haben sie nirgends anders geholt, als in dem Berg, in den du sie geschickt hast, dass sie nicht wiederkommen sollten. Jetzt aber will ich auch keine Bettlerin mehr bleiben. Auf der Stelle packst du den Sack da auf und kommst mir nicht wieder, ohne dass er voll Dukaten ist!“
Einreden half dem Wirt nicht. Er musste ohne Zaudern hinaus in den Wald, den Weg rechter Hand, das zweite Pfädchen links und hinein in den verzauberten Berg. Wer aber an der ersten Brücke stand war niemand anders als der Teufel. Der frug hin: „Wohinaus mit deinem Sack?“
„Geld abholen für meine Frau!“
Da erwischte ihn der Teufel am Camisol (Anm. Red.: Kleidungsstück, vergleichbar mit einer Weste) und brach ihm das Genick ab. Das hatte er nun davon.
Die Wirtin daheim konnte es aber nicht aushalten vor Erwartung und Ungeduld nach dem schönen Gold. Sie dachte, es möchte ihm zu schwer werden unterwegs. Sie könnte ihm ja entgegen laufen und es ihm abnehmen.
Sie kam bis vor den Berg und wartete erst noch eine Zeitlang vor der Tür. Doch als der Wirt immer noch nicht erschien, dachte sie: Er hat zu schwer geladen und kann es nicht allein auf die Achsel heben. Du willst hineingehen und ihm helfen! Also ging sie hinein und kam zu der ersten Brücke, wo der Teufel stand und auf sie wartete. „Wohinaus, liebe Frau?“ frug er. „Zu meinem Mann!“ „Da kann sie hinkommen liebe Frau“, sprach der Teufel, griff sie bei den Haaren, drehte ihr den Hals ab und warf sie hinab zu ihrem Manne. Jetzt waren sie beisammen.
Den achtzehn Soldaten ging es besser. Da die Zahl durch den Rekruten voll geworden war, so kamen die Prinzessinnen wieder angefahren. Immer eine nach der Andern, jede zu ihrem Liebsten. Alle, bis zum Achtzehenten, hielten es diesmal richtig aus.
Als die letzte Prinzessin dagewesen war, da kamen sie des anderen Abends alle Achtzehn auf ein Mal. Die Älteste aber sprach: „Heute Nacht müsst ihr die Erlösung zu Ende bringen. Eine Jede von uns lebt zu ihrem Bräutigam. Aber ruhig und stille muss ein Jeder bei seiner Prinzessin liegen und Keiner reden oder sich rühren, bis es Reveille (Anm. Red: morgentlicher Weckruf) schlägt. So geschah´s.
Sie legen sich alle sechsunddreißig zusammen und alle hielten Tapfer aus, nur der Tambour hätte beinahe alles verdorben. Denn gegen Morgen fiel es ihm plötzlich brühheiß ein: „Holla! Wer kann den die Reveille schlagen, wenn ich bei der Prinzessin liege“.
Als er gerade heraus springen wollte, da begann es auf einmal Reveille zu schlagen, aber was für eine Reveille! So hatte der Tambour noch keine gehört! Es war gerade als ob zehn mal hunderttausend Tamboure im Schlosshof stünden und schlügen!
Jetzt war alles Liebes und Gutes. Die älteste Prinzessin blieb mit dem Feldwebel im Schloss wohnen, das nun erlöst war. Die anderen fuhren mit ihren Männern fort, die eine dahin, die andere dorthin, weine eine jede ihr Königreich hatte. Die Brücke war jetzt gut passieren, denn der Teufel hatte nun andere Sachen zu tun, als dort Schildwacht zu stehen.
Deutsche Hausmärchen
Quelle: Deutsche Hausmärchen, herausgegeben von J. W. Wolf, Göttingen/Leipzig 1851, Dieterich´sche Buchhandlung + Fr. Chr. Wilh. Vogel


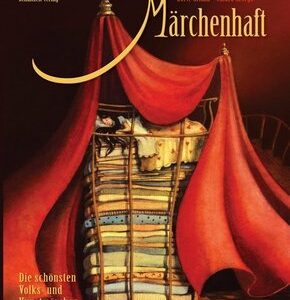
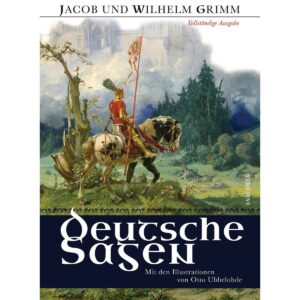

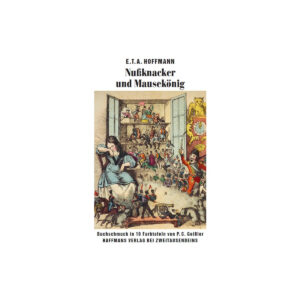








 Users Today : 0
Users Today : 0 Users Yesterday : 2
Users Yesterday : 2 Users This Month : 107
Users This Month : 107 Total Users : 1193
Total Users : 1193 Views Today :
Views Today :  Views Yesterday : 5
Views Yesterday : 5 Views This Month : 154
Views This Month : 154 Views This Year : 1515
Views This Year : 1515 Total views : 2087
Total views : 2087 Who's Online : 0
Who's Online : 0