Vom unsichtbaren Königreiche ist ein Märchen von Richard Leander. Es erzählt vom Leben des Traumjörge, der auf der Suche nach seiner Prinzessin auf den König der Träume trifft.
Das Märchen – Vom unsichtbaren Königreiche
In einem kleinen Hause, welches wohl eine Viertelstunde abseits von dem übrigen Dorfe auf der halben Berghöhe lag, wohnte mit seinem alten Vater ein junger Bauer, namens Jörg. Es gehörten zu dem Hause so viel Acker Feld, dass beide eben keine Sorgen hatten.
Gleich hinter dem Hause fing der Wald an, mit Eichen und Buchen, so alt, dass die Enkelkinder von denen, welche sie gepflanzt hatten, schon seit mehr als hundert Jahren tot waren. Vor ihm aber lag ein alter zerbrochener Mühlstein – wer weiß wie der dahin gekommen war. Wer sich auf ihn setzte, der hatte eine wundervolle Aussicht hinab ins Tal, auf den Fluss, der das Tal durchströmte und die Berge, die jenseits des Flusses aufstiegen.
Hier saß der Jörg am Abend, wenn er seine Arbeit auf dem Felde getan hatte, den Kopf auf die Hände und die Ellenbogen auf die Knie gestützt, oft stundenlang und träumte. Weil er sich wenig um die Leute im Dorf bekümmerte und meist still und in sich gekehrt einherging, wie einer, der an allerhand denkt, nannten ihn die Leute spottweise Traumjörge. Dies war ihm jedoch völlig gleichgültig.
Je älter er aber ward, desto stiller wurde er. Als sein alter Vater endlich starb und er ihn unter einer großen alten Eiche begraben hatte, wurde er ganz still. Wenn er dann auf dem alten zerbrochenen Mühlsteine saß, was er jetzt noch viel häufiger tat, als zuvor und hinab in das herrliche Tal sah, wie die Abendnebel an dem einen Ende hereintraten und langsam an den Bergen hinwandelten, wie es dann dunkler wurde und dunkler, bis zuletzt der Mond und die Sterne in ihrer ganzen Herrlichkeit am Himmel heraufzogen: dann wurde es ihm so recht wunderbar ums Herz. Dann fingen die Wellen im Fluss an zu singen. Anfangs ganz leise, bald aber deutlich und vernehmbar. Sie sangen von den Bergen, wo sie herkämen, vom Meer, wo sie hinwollten und von den Nixen, die tief unten im Grunde des Flusses wohnten. Darauf begann auch der Wald zu rauschen, ganz anders wie ein gewöhnlicher Wald und erzählte die wunderbarsten Sachen. Besonders der alte Eichbaum, der an seines Vaters Grabe stand, der wusste noch viel mehr wie alle die anderen Bäume. Die Sterne aber, die hoch am Himmel standen, bekamen die größte Lust, herabzufallen in den grünen Wald und in den blauen Strom und flimmerten und zitterten, wie jemand, der es gar nicht mehr aushalten kann. Doch die Engel, von denen hinter jedem Sterne einer steht, hielten sie jedes mal fest und sagten: „Sterne, Sterne, macht keine Torheiten! Ihr seid ja viel zu alt dazu, viele tausend Jahr und noch mehr! Bleibt im Lande und nährt euch redlich!“ –
Es war ein wunderbares Tal! – Aber alles das sah und hörte bloß der Traumjörge. Die Leute, welche im Dorf wohnten, ahnten gar nichts davon, denn es waren ganz gewöhnliche Leute. Dann und wann schlugen sie einen von den alten Baumriesen um, zersägten und zerspellten ihn und wenn sie eine hübsche Klafter aufgerichtet hatten, sprachen sie: „Nun können wir uns wieder eine Weile Kaffe kochen.“ und Im Fluss wuschen sie ihre Wäsche, das war ihnen sehr bequem. Von den Sternen aber, wenn sie so recht funkelten, sagten sie weiter nichts als: „Es wird heute Nacht recht kalt werden. Wenn nur unsere Kartoffeln nicht erfrieren.“ Versuchte es einmal der arme Traumjörge, ihnen eine andere Meinung beizubringen, so lachten sie ihn aus. Es waren eben ganz gewöhnliche Leute.
Wie er nun so eines Tages wieder auf dem alten Mühlsteine saß und bei sich bedachte, dass er doch auf der ganzen Welt so Mutterseelen allein sei, schlief er ein. Da träumte ihm, es hinge vom Himmel eine goldene Schaukel an zwei silbernen Seilen herab. Jedes Seil war an einem Sterne befestigt. Auf der Schaukel aber saß eine reizende Prinzessin und schaukelte so hoch, dass sie vom Himmel zur Erde herab und von der Erde wieder zum Himmel hinaufflog. Jedes mal, wenn die Schaukel bis an die Erde kam, klatschte die Prinzessin vor Freude in ihre Hände und warf ihm eine Rose zu. Aber plötzlich rissen die Seile und die Schaukel mit der Prinzessin flog weit in den Himmel hinein, immer weiter, immer weiter, bis er sie zuletzt nicht mehr sehen konnte.
Da wachte er auf und als er sich umsah, lag neben ihm auf dem Mühlsteine ein großer Strauß von Rosen.
Am nächsten Tag schlief er wieder ein un träumte dasselbe. Beim Erwachen lagen richtig die Rosen wieder da.
So ging es die ganze Woche hindurch. Da sagte sich Traumjörge, dass doch irgend etwas Wahres an dem Traume sein müsse, weil er ihn immer wieder träumte. Er schloss sein Haus zu und machte sich auf, die Prinzessin zu suchen.
Nachdem er viele Tage gegangen war, erblickte er von Weitem ein Land, wo die Wolken bis auf die Erde hingen. Er wanderte rüstig darauf zu, kam aber in einen großen Wald. Plötzlich hörte er hier ein ängstliches Stöhnen und Wimmern. Als er auf die Stelle zu gegangen war, von welcher da Gestöhn und Gewimmer herkam, sah er einen ehrwürdigen Greis mit silbergrauem Barte auf der Erde liegen. Zwei widerlich hässliche Kerle knieten auf ihm und suchten ihn zu erwürgen. Da blickte er sich um, ob er nicht irgend eine Waffe fände, mit der er den beiden Kerlen zu Leibe gehen könnte. Da er nichts fand, riss er in seiner Todesangst einen großen Baumast ab. Kaum jedoch hatte er diesen erfasst, als er sich in seinen Händen in eine mächtige Hellebarde verwandelte. Damit stürmte er auf die beiden Ungeheuer los und rannte sie ihnen durch den Leib, so dass sie mit Geheul den Alten losließen und fortsprangen.
Darauf hob er den ehrwürdigen Greis auf, tröstete ihn und frage, warum ihn die beiden Kerle hätten erwürgen wollen.
Da erzählte jener, er sei der König der Träume und aus Versehen etwas vom Wege ab in das Reich seines größten Feindes, des Königs der Wirklichkeit, gekommen. Sobald dies der König der Wirklichkeit bemerkt habe, hätte er ihm durch zwei seiner Diener auflauern lassen, damit sie ihm den Garaus machten.
„Hattest du denn dem König der Wirklichkeit etwas zu Leide getan?“ fragte Traumjörge.
„Behüte Gott!“ versicherte jener. „Er wird aber überhaupt sehr leicht gegen andere ausfällig. Das liegt in seinem Charakter – und mich besonders hasst er wie die Sünde!“
Darauf ging der König der Träume voran und Jörg folgte ihm. Als sie an die Stelle kamen, wo die Wolken auf die Erde hingen, wies der König auf eine Falltüre, welche so versteckt im Busch lag, dass sie gar nicht zu finden war, wenn man es nicht wusste. Er hob sie auf und führte seinen Begleiter fünfhundert Stufen hinab in eine hell erleuchtete Grotte, welche sich meilenweit in wunderbarer Pracht hinzog. Es war unsäglich schön! Da waren Schlösser auf Inseln mitten in großen Seen und die Inseln schwammen umher wie Schiffe. Wenn man in ein solches Schloss hineingehen wollte, brauchte man sich nur an das Ufer zu stellen und zu rufen:
„Schlösslein, Schlösslein, schwimm heran,
Daß ich in dich ´reingehen kann!“
dann kam es von selbst an das Ufer. Weiter waren noch andere Schlösser da auf Wolken. Die flogen langsam in der Luft. Sprach man aber:
„Steig herab, mein Luftschlösslein,
Dass ich kann in dich hinein!“
so senkten sie sich langsam nieder. Außerdem waren noch da Gärten mit Blumen, die am Tag dufteten und in der Nacht leuchteten, schillernde Vögel, die Märchen erzählten und eine Menge anderer ganz wunderbarer Sachen. Traumjörge konnte mit Staunen und Bewundern gar nicht fertig werden.
„Nun will ich dir auch noch meine Untertanen, die Träume, zeigen,“ sagte der König. „Ich habe deren drei Sorten. Gute Träume für die guten Menschen, böse Träume für die bösen und außerdem Traumkobolde. Mit den letzteren mache ich mir zuweilen einen Spaß, denn ein König muss doch auch zuweilen seinen Spaß haben.“ –
Zuerst führte er ihn also in eines der Schlösser, welches eine so verzwickte Bauart hatte, das es förmlich komisch aussah: „Hier wohnen die Traumkobolde,“ sprach er, „kleines, übermütiges, schabernackiges Volk. Tut niemandem was, aber neckt gern.“
„Komm einmal her, Kleiner,“ rief er darauf einem der Kobolde zu, „und sei einmal einen einzigen Augenblick ernsthaft.“ Hernach fuhr er fort und sagte zu Traumjörge: „Weißt du, was der Schelm tut, wenn ich ihm einmal ausnahmsweise erlaube, auf die Erde hinaufzusteigen? Er läuft ins nächste Haus, holt den ersten besten Menschen, der gerade wunderschön schläft, aus den Federn, trägt ihn auf den Kirchturm und wirft ihn kopfüber herunter. Dann springt er eiligst die Turmtreppe hinab, so dass er unten eher ankommt, fängt ihn auf, trägt ihn wieder nach Haus und schmeißt ihn so ins Bett, dass es kracht und er davon aufwacht. Dann reibt der sich den Schlaf aus den Augen, sieht sich ganz verwundert um und spricht: Ei du lieber Gott, war mir´s doch gerade, als wenn ich vom Kirchturm herabfiele. Es ist nur gut, dass ich bloß geträumt habe.“
„Das ist der?“ rief Traumjörge. „Siehst du, der ist auch schon einmal bei mir gewesen! Wenn er aber wiederkommt und ich erwische ihn, soll´s ihm schlecht ergehen.“ Kaum hatte er dies noch gesagt, so sprang ein andrer Traumkobold unter dem Tische hervor. Der sah fast aus wie ein kleiner Hund, denn er hatte ein ganz zottiges Wämslein an und die Zunge steckte er auch heraus.
„Der ist auch nicht viel besser,“ meinte der Traumkönig. Er bellt wie ein Hund und dabei hat der Kräfte wie ein Riese. Wenn dann die Leute im Traume Angst bekommen, hält er sie an Händen und Beinen fest, dass sie nicht fortkönnen.“
„Den kenne ich auch,“ fiel Traumjörge ein. „Wenn man fort will, ist es einem, als wenn man starr und steif wie ein Stück Holz wäre. Wenn man den Arm aufheben will, geht es nicht und wenn man die Beine rühren will, geht es auch nicht. Manchmal ist´s aber kein Hund, sondern ein Bär oder ein Räuber oder sonst etwas Schlimmes!“
„Ich werde ihnen nie wieder erlauben, dich zu besuchen Traumjörge,“ beruhigte ihn der König. „Nun komm einmal zu den bösen Träumen, aber fürchte dich nicht, sie werden dir keinen Schaden zufügen. Sie sind nur für die bösen Menschen. Damit traten sie in einen ungeheueren Raum ein, der von einer hohen Mauer umgeben und mittelst einer gewaltigen eisernen Türe verschlossen war. Hier wimmelte es von den gräulichsten Gestalten und den entsetzlichsten Ungeheuern. Manche sahen wie Menschen, manch halb wie Menschen, halb wie Tiere, manche ganz wie Tiere aus. Erschrocken wich Traumjörge zurück bis an die eiserne Tür. Doch der König redete ihm freundlich zu und sprach „Willst du dir nicht genauer besehen, was böse Menschen träumen müssen?“ Und er winkte einem Traume, der zunächst stand. Das war ein scheußlicher Riese, der hatte unter jedem Arme ein Mühlrad.
„Erzähle, was du heut Nacht tun wirst!“ herrschte der König ihn an.
Da zog das Ungeheuer den Kopf in die Schultern und den Mund bis zu den Ohren, wackelte mit dem Rücken, wie einer der sich so recht freut und sagte grinsend: „Ich gehe zum reichen Mann, der seinen Vater hat hungern lassen. Als der alte Mann sich eines Tages auf die steinerne Treppe vor dem Hause seines Sohnes gesetzt hatte und um Brot bat, kam der Sohn und sagte zum Gesinde: Jagt mir einmal den Hampelmann fort“ Da gehe ich nun nachts zu ihm und ziehe ihn zwischen den zwei Mühlrädern durch, bis alle seine Knochen hübsch kurz und klein gebrochen sind. Ist er dann so recht schmeidig und zapplig geworden, so nehme ich ihn am Kragen, schüttle ihn und sage: „Siehst du, wie hübsch du nun zappelst, du Hampelmann! Dann wacht er auf, klappert mit den Zähnen und ruft: Frau, bring mir noch ein Deckbett, mich friert. Und wenn er wieder eingeschlafen ist, mache ich´s auf´s Neue!“
Als Traumjörge die gehört, drängte er sich mit Gewalt zur Tür hinaus, den König nach sich ziehend und rief: „Nicht einen Augenblick länger bleibe ich hier bei den bösen Träumen. Das ist ja entsetzlich!“
Doch der König führte ihn nun in einen prächtigen Garten, wo die Wege von Silber, die Beete von Gold und die Blumen von geschliffenen Edelsteinen waren. In dem gingen die guten Träume spazieren. Das erste, was er sah, war ein Traum wie eine junge blasse Frau, die hatte unter dem einen Arme eine Arche Noah, unter dem anderen einen Baukasten.
„Wer ist denn das?“ fragte der Traumjörge.
„Die geht abends immer zu einem kleinen kranken Knaben, dem seine Mutter gestorben ist. Am Tag ist er ganz allein und niemand bekümmert sich um ihn. Aber gegen Abend geht sie zu ihm, spielt mit ihm und bleibt die ganz Nacht. Er schläft immer schon sehr früh ein, deshalb geht sie auch so zeitig. Die andern Träume gehen viel später. – Komm nur weiter, wenn du alles sehen willst, müssen wir uns sputen!“
Darauf gingen sie tiefer in den Garten hinein, mitten unter die guten Träume. Es waren Männer, Frauen, Greise und Kinder, alle mit lieben und guten Gesichtern und in den schönsten Kleidern. In den Händen trugen viele von ihnen alle mögliche Dinge, die sich das Herz nur wünschen kann. – Auf einmal blieb Traumjörge stehen und schrie so laut auf, dass alle Träume sich umdrehten.
„Was hast du denn?“ fragte der König.
„Da ist ja meine Prinzessin, die mir so oft erschienen ist und mir die Rosen geschenkt hat!“ rief Traumjörge ganz entzückt aus.
„Freilich, freilich!“ erwiderte Jener. „Das ist sie. Nicht wahr, ich habe dir immer einen sehr hübschen Traum geschickt? Es ist beinahe der hübscheste, den ich habe.
Da lief der Traumjörge auf die Prinzessin zu, die gerade wieder auf ihrer kleinen goldnen Schaukel saß und sich schaukelte. Sobald sie ihn kommen sah, sprang sie herab und ihm gerade in die Arme. Er aber nahm sie an der Hand und führte sie an eine goldene Bank. Da setzten sich beide hin und erzählten sich, wie hübsch es wäre, dass sie sich wieder sähen. Und wenn sie damit fertig waren, fingen sie immer wieder von vorn an. Der König der Träume aber ging mittlerweile fortwährend auf dem großen Wege, der gerade durch den Garten ging, auf und ab, die Hände auf dem Rücken. Zuweilen nahm er die Uhr heraus und sah nach, wie spät es wäre, weil der Traumjärge und die Prinzessin immer noch nicht mit dem fertig waren, was sie sich zu erzählen hatten. Zuletzt ging er jedoch wieder zu ihnen und sagte: „Kinder, nun ist es gut! Du, Traumjörge, hast noch weit zu Hause und über Nacht kann ich dich nicht hier behalten, denn ich habe keine Betten, weil nämlich die Träume nicht schlafen, sondern nachts immer zu den Menschen auf die Erde müssen. Du, Prinzesschen, du musst dich fertig machen. Zieh´ dich heute einmal ganz rosa an und nachher komm zu mir, damit ich dir sage, wem du heute erscheinen und was du ihm sagen sollst.
Als dies Traumjörge gehört, ward es ihm auf einmal so ganz mutig ums Herz, wie noch nie in seinem Leben. Er stand auf und sagte mit fester Stimme: „Herr König, von meiner Prinzessin lass´ ich nun und nimmermehr. Entweder ihr müsst mich hier unten behalten oder ihr müsst mir sie mit auf die Erde geben. Ich kann ohne sie nicht leben, dazu habe ich sie viel zu lieb!“ Dabei trat ihm in jedes Auge eine Träne, so groß wie eine Haselnuss.
„Aber Jörge, Jörge,“ erwiderte der König, „es ist ja der aller hübscheste Traum, den ich habe! Doch du hast mir das Leben gerettet, so sei es denn. Nimm deine Prinzessin und steige mit ihr hinauf zur Erde. Sobald du oben angelangt bist, so nimm ihr den silbernen Schleier vom Kopf und wirf ihn mir durch die Falltüre wieder herab. Dann wird deine Prinzessin von Fleisch und Blut wie ein anderes Menschenkind sein. Denn jetzt ist es ja nur ein Traum!“
Da bedankte sich Traumjörge auf das Herzlichste und sagte: „Lieber König, weil du nun einmal so überaus gut bist, so möchte ich wohl noch eine Bitte wagen. Sieh, eine Prinzessin habe ich nun, doch es fehlt mir immer noch ein Königreich. Es ist doch ganz unmöglich, dass du eine Prinzessin ohne ein Königreich sein kann. Kannst du mir denn keins verschaffen, wenn es auch nur ein ganz kleines ist?“
Darauf antworte der König: „Sichtbare Königreiche, Traumjörge, habe ich zwar nicht zu vergeben, aber unsichtbare. Davon sollst du eins bekommen und zwar eins der größten und herrlichsten, was ich noch habe.
Da fragte Traumjörge, wie es mit den unsichtbaren Königreichen beschaffen wäre Der König bedeutete ihn, er würde dies schon alles erfahren und sein blaues Wunder erleben, so schön und herrlich sei es mit den unsichtbaren Königreichen.
„Nämlich,“ sagte er, „mit den gewöhnlichen, sichtbaren ist es doch zuweilen eine sehr unangenehme Sache. Zum Exempel: du bist König in einem gewöhnlichen Königreiche und früh morgens tritt der Minister an den Bett und sagt: „Majestät, ich brauche tausend Taler fürs Reich. Darauf öffnest du die Staatskasse und findest auch nicht einen Heller darin. Was willst du dann anfangen? „Oder, zum andern: Du bekommst Krieg und verlierst und der andere König, der dich besiegt hat, heiratet deine Prinzessin. Dich aber sperrt er in einen Turm. So etwas kann in einem unsichtbaren Königreiche nicht vorfallen!“
„Wenn wir es nun aber nicht sehen,“ fragte Traumjörge, noch immer etwas betreten, „was kann uns dann unser Königreich nützen?“
„Du sonderbarer Mensch,“ sagte der König darauf und hielt den Zeigefinger an die Stirn, „du und deine Prinzessin, ihr seht es schon! Ihr seht die Schlösser und Gärten, die Wiesen und Wälder, die zum Königreich gehören, wohl! Ihr wohnt darin, geht spazieren und könnt alles damit machen, was euch gefällt. Nur die andern Leute sehen es nicht.“
Da war Traumjörge hoch erfreut, denn es war ihm schon etwas nicht ängstlich zu Mut, ob die Leute im Dorf ihn nicht scheel ansehen würden, wenn er mit seiner Prinzessin nach Hause käme und König wäre. Er nahm sehr gerührt Abschied vom König der Träume. Er stieg mit der Prinzessin die fünfhundert Stufen hinauf, nahm ihr den silbernen Schleier vom Kopf und warf ihn hinunter. Darauf wollte er die Falltüre zumachen, aber sie war sehr schwer. Er konnte sie nicht halten und ließ sie fallen. Da gab es einen ungeheuren Knall, fast so arg, als wenn viele Kanonen auf einmal losgeschossen werden und es vergingen ihm auf einen Augenblick die Sinne. Als er wieder zu sich kam, saß er vor seinem Häuschen auf dem alten Mühlstein und neben ihm die Prinzessin. Sie war von Fleisch und Blut wie ein gewöhnliches Menschenkind. Sie hielt seine Hand, streichelte sie und sagte: „Du lieber, guter, närrischer Mensch, du hast dich so lange nicht getraut, mir zu sagen, wie lieb du mich hast? Hast du dich denn vor mir gefürchtet?“ –
Und der Mond ging auf und beleuchtete den Fluss, die Wellen schlugen klingend ans Ufer und der Wald rauschte, doch sie saßen immer noch und schwatzten. Da war es plötzlich, als wenn eine kleine, ganz schwarze Wolke vor den Mond träte und auf einmal fiel etwas vor ihre Füße nieder, wie ein großes zusammengelegtes Tuch. Darauf stand der Mond wieder in vollem Glanze. Sie hoben das Tuch auf und breiteten es auseinander. Es war aber sehr fein und viele hunderte Male zusammengelegt, so dass sie viel Zeit brauchten. Als sie es vollständig auseinander gefaltet hatten, sah es aus wie eine große Landkarte. In der Mitte ging ein Fluss und zu beiden Seiten waren Städte, Wälder und Seen. Da merkten sie, dass es ein Königreich war und dass es der gute Traumkönig ihnen vom Himmel hatte herunterfallen lassen. Und als sie sich nun ihr kleines Häuschen besahen, war es zu einem wundervollen Schlosse geworden, mit gläsernen Treppen, Wänden von Marmelstein, Tapeten von Samt und spitzen Türmen mit blauen Schieferdächern. Da fassten sie sich an und gingen in das Schloss hinein. Als sie eintraten, waren schon die Untertanen versammelt und verneigten sich tief. Pauken und Trompeten erschallten und Edelknaben gingen vor ihnen her und streuten Blumen. Da waren sie König und Königin. – –
Am andern Morgen aber lief es wie ein Feuer durch das Dorf, dass der Traumjörge wiedergekommen sei und sich eine Frau mitgebracht habe. „Das wird auch was recht Gescheites sein,“ sagten die Leute. „Ich habe sie heute früh schon gesehen,“ fiel einer von den Bauern ins Wort, „als ich in den Wald ging. Sie stand mit ihm vor der Tür. Es ist nichts Besonderes, ein ganz gewöhnliche Person, klein und schmächtig. Ziemlich ärmlich war sie auch angezogen. Wo soll´s denn am Ende auch herkommen! Er hat nichts, da wird sie wohl auch nichts haben!“
So schwatzen sie, die dummen Leute, denn sie konnten es nicht sehen, dass es eine Prinzessin war. Und das das Häuschen sich in ein großes, wundervolles Schloss verwandelt hatte, bemerkten sie in ihrer Einfalt auch nicht, denn es war eben ein unsichtbares Königreich, was dem Traumjörge vom Himmel herabgefallen war. Aus diesem Grunde bekümmerte er sich auch um die dummen Leute gar nicht, sondern lebte in seinem Königreich und mit seiner lieben Prinzessin herrlich und vergnügt. Und er bekam sechs Kinder, eins immer schöner wie das andere und das waren lauter Prinzen und Prinzessinnen. Niemand aber wusste es im Dorf, denn das waren ganz gewöhnliche Leute und viel zu einfältig, um es einzusehen. –
————
Quelle: Träumereien. Märchen von Richard Leander
Boston, D. C. Heath And Co, 1888


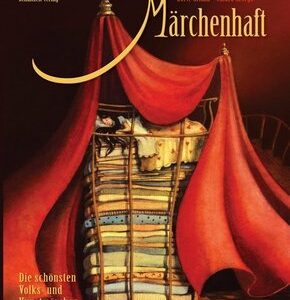
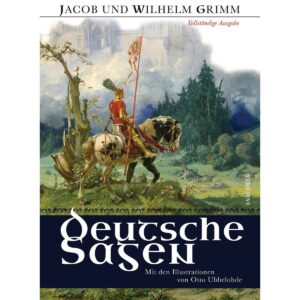

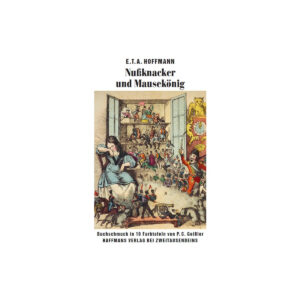








 Users Today : 2
Users Today : 2 Users Yesterday : 2
Users Yesterday : 2 Users This Month : 109
Users This Month : 109 Total Users : 1195
Total Users : 1195 Views Today : 3
Views Today : 3 Views Yesterday : 5
Views Yesterday : 5 Views This Month : 157
Views This Month : 157 Views This Year : 1518
Views This Year : 1518 Total views : 2090
Total views : 2090 Who's Online : 0
Who's Online : 0